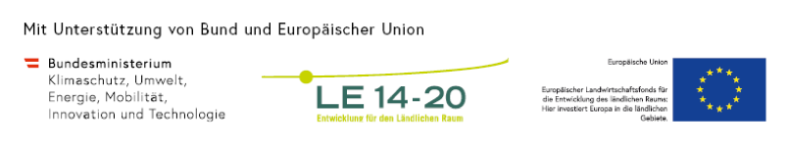Auf Basis der Projektplanungsgrundlage (Moitzi & Weigand, Dez. 2009) erfolgte im Frühjahr 2010 eine in Absprache mit der Naturschutzabteilung (Linz, Dr. A. Schuster) vorgenommene Ausschreibung und folgende Beauftragung des renommierten Schmetterlingsexperten-Teams Mag. Dr. Patrick Gros (Salzburg), Dr. Matthias Dolek (Bayern) und Mag. Dr. Martin Schwarz (Kirchschlag, OÖ). Die detaillierte Planungsgrundlage der Nationalpark Verwaltung mit mehr als 24.000 dokumentierten Schmetterlingsfunden (Macrolepidoptera) ermöglichte die Eingrenzung auf 5 (6) Untersuchungsgebiete und bedingt somit eine deutliche Kostenreduzierung der Freilandaufnahmen.
Im ersten Jahr der Untersuchung wurden über 700 Datensätze zu beinahe 100 Schmetterlingsarten an 95 verschiedenen Fundorten des Nationalpark Kalkalpen gesammelt. Darüber hinaus gelangen bereits wichtige Erkenntnisse über die aktuelle Lage der Hauptzielarten im Nationalpark: Die vermutlich wichtigste (und wahrscheinlich auch einzige) Population vom Eschen-Scheckenfalter (auch Kleiner Maivogel genannt) im Nationalpark konnte bereits recht genau abgegrenzt werden: Hinsichtlich des Goldenen Scheckenfalters (auch Skabiosen-Scheckenfalter genannt) sind die vorhandenen, potenziellen Habitate (v. a. im Bereich der Puglalm) derzeit nicht besiedelt, wobei die Art im Nationalpark derzeit leider als verschollen anzusehen ist. 2011 wird versucht, ein eventuelles Vorkommen der alpinen Unterart zu klären.
Sämtliche, weitere EU-geschützte Arten wurden 2010 im Nationalpark beobachtet. Der Apollo konnte in einem typischen Habitat gesichtet werden, nicht aber in der für diese Art vorgesehenen Untersuchungsfläche. Der Schwarze Apollofalter besitzt ein gutes Vorkommen, wo 2011 die Habitatansprüche näher untersucht werden sollen. Der Thymian-Ameisenbläuling konnte auf Almen angetroffen werden, wo auch typische Larvalhabitate vorgefunden wurden. Der Gelbringfalter ist eine diskrete (kurze Flugzeit), aber vermutlich häufige und eine sehr charakteristische Art des Nationalpark Kalkalpen, die in sehr lichten Waldbereichen mit gut entwickelter Krautschicht auf eher mageren Böden oft beobachtet wurde. Die Spanische Flagge (auch Russischer Bär genannt) wurde in den offenen Waldbereichen des Nationalparks zu ihrem späten Flugzeitpunkt regelmäßig gesichtet, wobei anzunehmen ist, dass es sich um eine im Nationalpark verbreitete und häufige Art handelt.
Diese Erkenntnisse bilden eine bereits solide Basis für die geplanten, weiteren Schritte der Untersuchung, die uns letztendlich zu deren eigentlichen Zielen (Bewertung des Erhaltungszustandes der Populationen, Auswahl von Monitoringflächen, Einbeziehung von Parametern der Biotopkartierung und der Naturrauminventur, Managementvorschläge) führen werden.