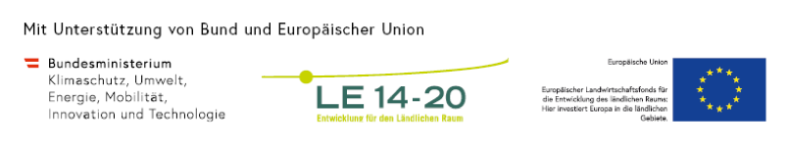Lateinischer Name: Picoides leucotos
Charakteristik: Etwas größer als Buntspecht, rein schwarzer Rücken, im hinteren Bereich weiß (Name!), Männchen roter Scheitel
Lebensraum: Naturwald, aufgelockert und mit hohem Totholzanteil, südexponierte Lagen
Verhaltensweisen: Lebt hauptsächlich von Insekten und deren Raupen und Puppen aus Totholz, hält sich dabei eher in Bodennähe auf, daher auch an liegenden Stämmen.
Der Weißrückenspecht ist der seltenste Specht Österreichs und die bedeutendste Vogelart des Nationalpark Kalkalpen. Wegen der strikten Bindung an starkes Totholz beschränkt sich sein Vorkommen auf naturnahe Wälder. Er ist eine ausgeprägte Indikatorart für Urwälder.
Mit einer Körperlänge von 25 bis 28 cm ist der Weißrückenspecht innerhalb der Gruppe der „Buntspechte” am größten. Wichtige Kennzeichen sind der weiße Rücken, die breite weiße Flügelbänderung und die schwarze Strichelung auf den Flanken der sonst weißen Unterseite. Die Unterschwanzdecken sind im Gegensatz zum Großen Buntspecht hellrot. Das Männchen weist, ähnlich dem jungem Buntspecht, eine rote Kopfplatte auf, das Weibchen eine schwarze.
Die Hauptverbreitung des Weißrückenspechtes reicht von Nordosteuropa bis Ostasien. Die anderen europäischen Vorkommen sind stark zersplittert und auf höhere Gebirgszüge beschränkt. Im Alpenraum kommt er nur an der Alpennordseite, vom Wienerwald bis Vorarlberg, vor. In den Nördlichen Kalkalpen bewohnt der Weißrückenspecht totholzreiche, von Buchen dominierte Laubmischwälder. Selbst die Bruthöhle wird ausschließlich in toten Stämmen oder zumindest in einem abgestorbenen Wipfel oder Seitenast angelegt, meist in Buche oder Ahorn. Die Hauptnahrung stellen Bockkäferlarven aus dem Totholz dar. Typische Lebensräume sind unbewirtschaftete Steillagen und Schutzwälder sowie Lawinenhänge.
Die Bestände an der Alpennordseite wurden wegen seiner Scheu und der schwierigen Erfassbarkeit dieser Vogelart lange unterschätzt. Die aktuellen artspezifischen Erhebungen im Ötschergebiet (Niederösterreich) erlauben erstmals auch eine konkrete Bestandsschätzung für Oberösterreich mit 200 bis 500 Brutpaaren. Im Nationalpark Kalkalpen sind es etwa 30 bis 50 und es ist zu erwarten, dass sich der Bestand durch die Einstellung der Waldnutzung künftig erhöht.
Status, Gefährdung und Schutz
Status Nationalpark Kalkalpen: Brutvogel, nicht häufig
Status Oberösterreich (2005): sehr seltener Brutvogel
Rote Liste Österreich (2005): Gefährdung droht
Rote Liste Oberösterreich: gefährdet
Gefährdung in Europa: (2003) nicht gefährdet
Schutzverantwortung Österreich: stark verantwortlich
Handlungsbedarf für Österreich: Schutzbedarf gegeben
Vogelschutz-Richtline der EU: Anhang I
Naturschutzgesetz Oberösterreich: geschützt